Glaubensserie (18): Die Arbeiter im Weinberg
Vergleichen macht unglücklich

- Heinrich Bedford-Strohm
- Foto: epd-bild/Heike Lyding
- hochgeladen von Online-Redaktion
Was ist der gerecht: gleicher Lohn für alle oder leistungsorientiere Bezahlung für geleistete Arbeit? Ungerechtigkeit mag hier Murren, Widerspruch oder Wut heraufbeschwören. Jesus nutzt für das, was in den Augen Gottes gerecht ist, Bilder und Gleichnisse. Um ein solches Gleichnis geht es in dieser Folge der Glaubensserie.
Von Heinrich Bedford-Strohm
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg hat mich immer schon angezogen. Schon in meinem Theologiestudium habe ich meine erste Seminararbeit im Neuen Testament darüber geschrieben. Ein Grund war die Sperrigkeit des Gleichnisses, die mir gefallen hat. Es bürstet das gegen den Strich, was wir normalerweise empfinden. Die meisten von uns würden es jedenfalls als ungerecht empfinden, wenn jemand, der den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet hat, keinen Cent mehr dafür bekommt als jemand, der nur eine einzige Stunde gearbeitet hat. Das geht uns schon ganz schön gegen den Strich.
Der andere Grund dafür, dass mich dieses Gleichnis immer schon so angesprochen hat, ist seine Lebensnähe. Die Existenz als Tagelöhner im biblischen Israel können wir uns heute nur noch ausmalen. Aber die Gefühle, die sich in der Geschichte Bahn brechen, kennen wir genau. Und in die Situation können wir uns ja auch heute noch hineinversetzen. Der Herr des Weinbergs braucht Arbeiter für die Ernte. Und die Menschen, die da auf dem Marktplatz auf Arbeit warten, brauchen Geld, um ihre Familie durchzubringen. Auf einen Silbergroschen einigt man sich als Tagelohn. Das ist ziemlich genau so viel, wie man damals brauchte, um seine Familie ernähren zu können. Die Ersten, die der Weinbergbesitzer einstellte, werden froh gewesen sein, dass sie die Chance bekamen, das zu verdienen, was sie brauchten. Die anderen, die später eingestellt wurden und daher nur weniger arbeiten konnten, werden sich gesagt haben: Besser als nichts! Und die Letzten, die nur noch eine Stunde arbeiten konnten, werden vielleicht schon ziemlich verzweifelt gewesen sein. Für sie war die eine Stunde jedenfalls ein Lichtstreifen am Horizont.
Und jetzt kommt die Szene der Lohnauszahlung mit der unerwarteten Wendung. Erst geht alles seinen normalen Gang. Die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben, bekommen den vereinbarten Lohn. Doch dann die Überraschung: Alle bekommen den gleichen Lohn, sogar die, die nur eine Stunde gearbeitet haben! Es fällt nicht schwer, sich in die Gefühle hineinzuversetzen, die da hervorgebrochen sein mögen. Die einen, die den ganzen Tag gearbeitet haben, bekommen in der Geschichte auch explizit eine Stimme: Sie murren gegen den Hausherrn und sagen: »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben.« Sie sind sauer, weil sich ihre Leistung nicht gelohnt hat.
Wie es den anderen ergangen ist, kann man nur vermuten. Es werden Glücksgefühle gewesen sein, dass der Tag für sie am Ende doch noch so gut ausging. Dass sie nun doch noch das Geld nach Hause bringen würden, das sie brauchten, um ihre Familie zu ernähren.
Eigentlich hätten sich alle mitfreuen können. Eigentlich hätte man die Geschichte auch als Happy End für alle verstehen können. Denn der Herr des Weinbergs hat sein Versprechen ja eingehalten, die Arbeit mit einem Silbergroschen zu bezahlen. Genau damit konfrontiert er auch den, der murrt: »Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin?«
Die Frage sitzt. Die Gefühle sagen etwas anderes: Es ist ungerecht, dass sich die eigene Leistung nicht in einem höheren Lohn auszahlt. Trotzdem bleibt der Stachel der Frage: Was ist es, was dich davon abhält, es dem anderen schlicht und einfach zu gönnen, dass er auch in den Genuss eines auskömmlichen Lohnes kommt? Warum bist du so hart? Warum kannst du dich nicht einfach in den anderen hineinversetzen und dir vorstellen, welche Dankbarkeit er dafür empfindet, dass er nun doch genug zum Leben haben wird? Und warum kannst du nicht einfach Hochachtung gegenüber dem Herrn des Weinbergs empfinden, der so großzügig ist? Der denen, die es brauchen, einfach mehr gibt, als er müsste?
„Es ist ein viel glücklicheres Leben, wenn wir Neid überwinden und anderen einfach etwas gönnen, auch wenn wir selbst es nicht oder noch nicht haben.“
Immer wieder gibt es auch heute Anlass, sich diese Fragen zu stellen. Etwa wenn Menschen, die viele Kinder und keine Arbeit haben, vom Staat Geld bekommen und andere sagen: Dafür muss ich hart arbeiten! Und die kriegen das einfach so! Andererseits ist das Sozialgeld ja nicht üppig, sondern so bemessen, dass eine Familie damit eben gerade so durchkommt.
Oder wenn während der Corona-Pandemie die Frage aufkam, ob die Restaurants für Geimpfte wieder aufmachen könnten. »Nein«, haben viele gesagt, denn es wäre ungerecht, wenn die Glücklichen, die in der Phase der Impfstoffknappheit einen frühen Impftermin ergattern, dann auch noch sichtbare Privilegien wie Restaurantbesuche bekommen, während die anderen davon ausgeschlossen bleiben. Andererseits: Wem nützt es, wenn auch diejenigen, von denen keine nennenswerte Gefahr mehr ausgeht, nicht essen gehen können? Sollten wir es ihnen nicht gönnen und uns mit den Kneipenbesitzern freuen, dass sie jedenfalls ein Minimum an Geschäft machen können?
Das Nicht-gönnen-Können steht dem Glück im Wege. Das jedenfalls diagnostiziert der Glücksforscher Karl-Heinz Ruckriegel, wenn er als einen seiner sieben Glücksratschläge formuliert: »Vermeiden Sie … soziale Vergleiche. Neid und Glück passen nicht zusammen.«
Es ist ein viel glücklicheres Leben, wenn wir Neid überwinden und anderen einfach etwas gönnen, auch wenn wir selbst es nicht oder noch nicht haben. Den sozialen Beziehungen jedenfalls tut das gut. Denn aus der Knappheit zu leben, aus der Angst, zu kurz zu kommen, wirkt auf die anderen viel weniger gewinnend, als aus der Fülle zu leben und Großzügigkeit zu zeigen. Großzügigkeit schafft Freunde. Dass das keine Frage des Geldbeutels ist, zeigen die Menschen, die gerade mit dem wenigen, das sie haben, großzügig sind. Wo wir das erleben, beeindruckt es uns, vielleicht beschämt es uns auch, weil wir selbst so viel mehr auf das Unsere achten.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ist also auch ein bisschen eine Schule der Lebenskunst, indem es uns bei unseren Neidgefühlen abholt und unser Herz öffnet für den Segen der Großzügigkeit und Barmherzigkeit.
Jesus verwendet dieses Gleichnis im Gesamtzusammenhang des Matthäusevangeliums übrigens nicht im Kontext eines materiellen Verteilungsstreits. Sondern es geht um die Nähe zu Jesus, zu Gott. Die Söhne des Zebedäus streiten sich darum, wer näher bei Jesus sitzen darf. Freuen wir uns über andere, die erst viel später zum Glauben, zur Gemeinde finden als wir? Oder beanspruchen wir als »Alteingesessene« eine Vorrangstellung? Wie einladend sind wir als Kirche? Begegnen wir den andere mit ausgestreckten Armen? Oder beharren wir auf Regeln, die andere ausschließen. Sollen auch Nicht-Kirchenmitglieder einen Segen bekommen können? Oder unterminiert das die Bereitschaft der Kirchenmitglieder, treu ihre Beiträge zu zahlen? Aus der Geschichte lese ich den Aufruf: Lasst uns auch bei Segen großzügig mit anderen sein!
Wenn es um die Ausstrahlung geht, die ich mir für uns als Kirche wünsche, dann denke ich zuallererst an Worte Martin Luthers aus seiner Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen«: »Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus der Liebe ein freies, fröhliches, williges Leben, dem Nächsten umsonst zu dienen.«
Wäre es nicht wunderbar, wenn wir so leben könnten? Wäre es nicht die glücklichste aller Lebensweisen, wenn wir so aus der Fülle der Liebe Gottes leben und diese Liebe anderen gegenüber ausstrahlen könnten? Weil ich diese Frage mit einem klaren Ja beantworte, bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Frömmigkeit, die das alles in unser Herz bringt, kein Auslaufmodell ist, sondern ein absolutes Zukunftsmodell. Denn: Frömmigkeit und Glück gehören zusammen. Die Aufnahme des Gleichnisses Jesu von den Arbeitern im Weinberg in die eigene Seele ist das beste Beispiel dafür.
Der Autor ist Moderator (Vorsitzender) des Ökumenischen Rates der Kirchen.
Gesprächsimpulse
- »Das Nicht-Gönnen-Können steht dem Glück im Wege«: Inwieweit können Sie diese These aus Ihrer Lebenserfahrung bestätigen?
- Wie einladend soll die Kirche sein? Gibt es da aus Ihrer Sicht Grenzen? Warum sollen auch Nicht-Kirchenmitglieder einen Segen bekommen können?
Nächste Folge: Mose und der Bund am Sinai (2. Mose, Kapitel 24 und 34)


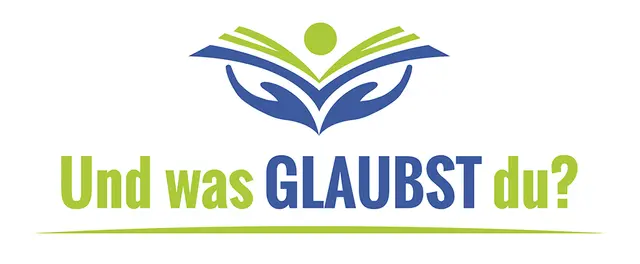
Autor:Online-Redaktion |

Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.