Bilanz Missbrauchsaufarbeitung
"Aufarbeitung kann nie enden"
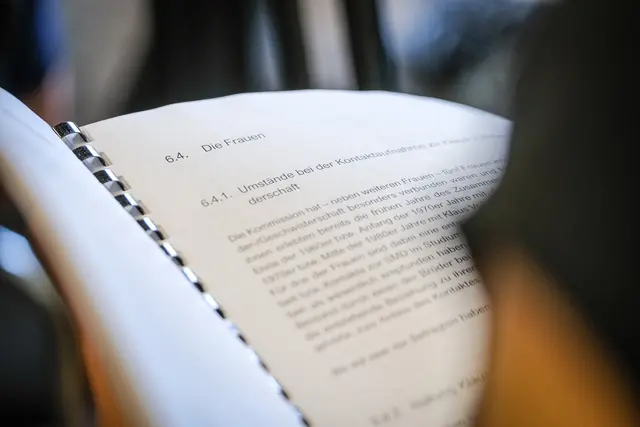
- Foto: epd-bild/Jens Schulze
- hochgeladen von Beatrix Heinrichs
In die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und die Entwicklung von Vorsorgekonzepten hat bisher keine Institution in Deutschland so viel Geld und Ressourcen investiert wie die katholische Kirche. Auch weil vielleicht kaum eine andere Institution so viel Missbrauch, Gewalt und Vertuschung ermöglicht hat.
Von Volker Hasenauer
Zugleich gibt es weiterhin Kritik, wonach die Kirche immer noch zu wenig tue für eine wirklich unabhängige, schonungslose und transparente Aufarbeitung. Aktuell prägen vor allem die von Missbrauchsopfern angestrengten Gerichtsverfahren mit hohen Schmerzensgeldforderungen das öffentliche Bild.
Ausgelöst durch erste Betroffenenberichte an einer Berliner Jesuitenschule 2010, denen viele weitere folgten, wurde 2018 die MHG-Studie als bundesweite Analyse von kirchlichen Personalakten veröffentlicht. Sie brachte ein bis dato unbekanntes Ausmaß von Missbrauch, Übergriffen, Gewalt und deren systematischer Vertuschung inklusiver Täterschutz ans Licht. Zuvor war eine erste bundesweite Studie gescheitert.
Arbeit wenig bekannt
Seitdem liegt die weitere Aufarbeitung vor allem in den Händen von unabhängigen Kommissionen (UAK), die in allen 27 Bistümern entstanden. Diese ehrenamtlich arbeitenden und von den Bistümern durch Aufwandsentschädigungen honorierten Kommissionen sind häufig mit früheren Polizisten und Juristen oder auch Medizinern und Psychologen besetzt. Hinzu kommen Betroffenenvertreter sowie von den jeweiligen Landesregierungen benannte Vertreterinnen oder Vertreter. Zumeist arbeiten die UAKs weitgehend unter dem öffentlichen Radar.
Grundlage für ihre Arbeit ist eine 2020 geschlossene Vereinbarung ("Gemeinsame Erklärung") zwischen der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.
Fünf Jahre später hat die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) nun bei den Kommissionen nachgefragt, was und wie sie arbeiten. Welche Ergebnisse gibt es? Und welche Hindernisse und Probleme bestehen?
Weitere Studien erwartet
Dabei zeigt sich, dass eine Vielzahl couragierter Kommissionsmitglieder ein enorm breites Feld beackert. Alle UAKs betonen ihre Unabhängigkeit und ihre Priorität, vor allem den Missbrauchsbetroffenen verpflichtet zu sein. Die Kommissionen haben zahlreiche Berichte und Studien in Auftrag gegeben oder selbst erarbeitet. Neben den bereits veröffentlichten sind für die kommenden Monate weitere Berichte und Studien angekündigt. Zudem finden sich auf den Internetseiten jährliche Tätigkeitsberichte vieler Kommissionen.
Viele Kommissionen bedauern jedoch, dass es bis heute keine echte Zusammenschau und systematische Auswertung der Ergebnisse gibt. "Wir brauchen unbedingt eine bundesweite Analyse, die die Ergebnisse zusammenführt und daraus zukunftsgewandte Empfehlungen für Prävention und nötige Strukturveränderungen ableitet", sagte ein Kommissionsvorsitzender der KNA.
Bischöfe kündigen bundesweite Auswertung an
Weil eine solche Zusammenschau teuer und aufwendig ist, sehen die Kommissionen hier die Bischöfe in der Pflicht. Auf Anfrage kündigte der Sprecher der Bischofskonferenz nun erstmals eine solche Auswertung und Gesamtanalyse an - allerdings ohne konkreter zu werden, wann und wie das geschehen wird.
Deutlich machen die Recherchen auch, dass es vielerorts sehr lange gedauert hat, bis die Kommissionen überhaupt zusammengetreten sind. Häufig hing es auch daran, dass die Bundesländer lange brauchten, um Mitglieder zu benennen. Die jüngste Kommission ist die Ende 2023 begründete UAK im Bistum Essen.
Kurzen Prozess hat die Kommission im Bistum Fulda gemacht: Berufen durch den Fuldaer Bischof im September 2021 hat sie als bundesweit erstes Gremium kürzlich ihren Abschlussbericht vorgelegt - und damit satzungsgemäß ihren Arbeitsauftrag erfüllt.
Eklat im Osten
Die gemeinsame Kommission für Berlin, Dresden, Görlitz und die Militärseelsorge ist - das ist bundesweit einmalig - Ende Mai von den Ortsbischöfen aufgelöst worden. Unter Verweis auf unüberbrückbare Differenzen innerhalb der Gruppe. Kritiker werfen den Bischöfen hier vor, zu wenig für eine Weiterarbeit der Gruppe und eine Moderation der Arbeit getan zu haben. Wann es hier zu einem Neustart kommt, ist derzeit unklar.
Große Reibungen gibt es auch in der Kommission Nord für die Bistümer Hamburg, Hildesheim und Osnabrück. Die Kommission wirft dem Erzbistum Hamburg massive Widerstände gegen die Aufklärung sexualisierter Gewalt vor. So teile Hamburg - anders als Hildesheim und Osnabrück - unter Verweis auf Datenschutz auch der UAK keine Täternamen mit.
Dass die Arbeit der Kommissionen zeitlich auf sechs Jahre befristet ist, sorgt bei manchen Beobachtern für Verwunderung, ist aber im Vertrag zwischen Bischofskonferenz und UBSKM so vereinbart. Auch wenn die entsprechende Formulierung gewisse zeitliche Spielräume für möglicherweise verlängerte Kommissionsmandate ermöglicht.
Aus mehreren Kommissionen ist zu hören, dass die ehrenamtliche Arbeit Grenzen haben müsse. Es gelte nun, die erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Ideen umzusetzen. "Jetzt müssen Jüngere diese Arbeit fortführen und vor allem für die Umsetzung in den kommenden Jahren kämpfen", heißt es aus einer Kommission.
Denkanstöße warten auf Umsetzung
Genügend Ideen, Arbeitspapiere und Kataloge gibt es. Zusammengefasst sind die Vorschläge bereits in einem internen Bericht ("Denkanstöße") aus dem Jahr 2022 für ein bundesweites Treffen der UAK-Vorsitzenden. Zu den Vorschlägen zählt - wie unlängst auch vom Jesuiten Klaus Mertes wiederholt - die Finanzierung der Aufarbeitung auch für finanzschwache Bistümer und Ordensgemeinschaften auf ein gemeinsames Fundament zu stellen - etwa durch einen bundesweiten Fonds. Und dringlich ist für die UAK Eichstätt, die die "Denkanstöße" erarbeitet hat, auch ein größerer Druck des Staates auf kirchliches Aufarbeiten.
Die Beauftragte der Bundesregierung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, äußert sich nur sehr zurückhaltend. Sie vermisse bei den Kirchen eine "einheitliche Lesart bei der Umsetzung" der Gemeinsamen Erklärung, sagt sie. Alle Missbrauchsbetroffene müssten die gleiche Unterstützung erhalten. Gleiches gelte auch, so Claus, für die evangelische Kirche, die erst deutlich später als die katholische einen Vertrag zur unabhängigen Aufarbeitung unterzeichnet hat.
Der Speyerer UAK-Vorsitzende Wolfgang Schwarz beschreibt es so: "Aufarbeitung ist die beste Prävention. Deshalb wird das Thema nie zu Ende sein."
(KNA)
Autor:Online-Redaktion |

Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.