Glaubensserie (19): Mose und der Bund am Sinai
Wenn Gott in Vorleistung geht

- Das Katharinenkloster am Berg Sinai ist heute Ausgangspunkt für die Besteigung des Ortes, wo Mose die Gebote empfing.
- Foto: Doin Oakenhelm – stock.adobe.com
- hochgeladen von Online-Redaktion
Wie kann die Beziehung Gottes zu den Menschen am besten beschrieben werden? Im Alten Testament wird dafür der "Bund" als Begriff – im Hebräischen "berît" – genutzt. "Berît" steht auch für einen Vertrag und verdeutlicht: Gott fordert nicht nur, er bindet sich auch an uns.
Von Rüdiger Lux
»Jedes Volk, in seiner Jugend zumal, will die Kunde von seinem Anfang besitzen, es erzählt und dichtet von ihm«. Mit diesen Worten beginnt der Rabbiner Leo Baeck, letzter Vorsitzender der »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland« und Häftling im KZ Theresienstadt, das erste Kapitel seines Buches »Dieses Volk – Jüdische Existenz.« Das Kapitel trägt die schlichte Überschrift »Der Bund«. Der Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel, das war und ist der Grundgedanke, besser noch die Grund- und Lebenserfahrung dessen, was die jüdische Existenz bis heute ausmacht.
Bereits die biblischen Erzähler und Dichter Israels haben in den fünf Büchern Mose ihre Anfangsgeschichte als Geschichte eines Bundes zwischen Gott und Mensch entworfen. Wie ein roter Faden zieht sich das Motiv des »Bundes« durch die Tora, diesen gewaltigen Gründungsmythos Israels. Nach der großen Flut ist zunächst vom Noahbund die Rede, in dem sich der Schöpfer selbst gegenüber Mensch und Tier verpflichtete: Nie wieder soll es Flut und Verderben geben! Zum Zeichen dafür steht der Regenbogen in den Wolken (1. Mose 9). Es folgt der Bund mit Abraham und Sara. Gott verheißt dem kinderlosen Paar einen Sohn sowie das Land Kanaan als Besitz für seine Nachkommen (1. Mose 15; Vers17).
Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg, dessen Ziel erst mit Mose in Sicht kam, dem Knecht Gottes. Nach der Flucht aus der Sklaverei in Ägypten und dem Weg durch die Wüste kam Israel zum Gottesberg Sinai. Alle Erfahrungen, die das Volk in den Jahrhunderten seiner Geschichte mit Gott gemacht hatte, verdichteten die biblischen Erzähler zu einem hochpoetischen Text von außerordentlicher Symbolkraft, der Erzählung vom Bundesschluss am Sinai (2. Mose, Kapitel 19-24). Es war dieser Berg, an dem Israel seinem Gott in der Wüste begegnete, dem unsichtbaren, unnahbaren Gott und seinem Geheimnis, das sich nur in Bildern und Symbolen erschließt.
Wer heute nach dem Berg Sinai sucht, wird von der frommen Tradition an den Djebel Musa, den Moseberg auf der Sianihalbinsel verwiesen. Vom Fuße dieses Berges aus, an dem Gott Mose seinen Namen offenbarte, führt der mehrstündige Weg hinauf auf den 2285 m hohen Gipfel des Berges. Noch heute brechen Heerscharen von Touristen in dunkler Nacht vom weltberühmten Katharinenkloster am Fuße des Berges auf, um am Morgen bei aufgehender Sonne eine Ahnung von dem Glanz zu erhaschen, der sich nach 2. Mose, Kapitel 24, Mose und seinen Helfern zeigte. »Sie sahen den Gott Israels« und sahen doch nicht mehr von ihm als »eine Fläche unter seinen Füßen« die wie ein himmelblauer Saphir schimmerte. Selbst der Gipfel des Djebel Musa gab und gibt das Geheimnis des unsichtbaren Gottes nicht preis.
Was all diese Bundesschlüsse der Tora mit Noah, Abraham und dem Volk Israel gemeinsam haben, ist dies: dass die Initiative dazu stets von Gott ausging. Er ging gegenüber seinen Bundespartnern eine Selbstverpflichtung ein. Er gibt, bevor er fordert: Den Frieden zwischen sich und seiner Schöpfung (Noah); einen Sohn und reiche Nachkommenschaft für das kinderlose Paar (Abra-ham und Sara); Freiheit und das Land Kanaan für entlaufene Sklaven (Mose). Nie zwingt er seinen Bundespartnern einen Vertrag auf, diktiert ihnen Vorbedingungen. Gott geht in Vorleistung. Sein Angebot geht den Geboten voraus. Er ist es, der Gemeinschaft sucht, der gesellige Gott, der seine Schöpfung und sein Volk nicht sich selbst überlässt.
In 2. Mose, Kapitel 24 wird dieser Bund, der ganz und gar Gabe Gottes ist, Zusage seiner befreienden Gegenwart und seines Schutzes, in einer feierlichen Bundeszeremonie besiegelt. Mose empfängt die beiden aus Fels geschlagenen Tafeln vom Sinai, die Gründungsurkunde des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Was es vom Gott Israels zu sehen und zu wissen gibt, steht auf diesen beiden Tafeln geschrieben: Regeln des Lebens sind es, damit die Freiheit nicht in Regellosigkeit und Willkür verkommt. Nicht Last sollen sie sein, die Gebote, sondern Wind unter den Flügeln der Befreiten.
Und wenn der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer betont, dass den Israeliten nach wie vor »die Kindschaft (Gottes) gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse …« (Römer 9, Vers 4), dann sollte uns Christen das zu denken geben. Gott hat seinen Bund mit Israel nicht gekündigt!
Der Autor ist ist emeritierter Professor für Altes Testament an der Universität Leipzig.
Gesprächsimpulse
- Welche Bindungen machen frei und welche unfrei?
- Wo und wie lassen sich Erfahrungen mit dem »geselligen Gott« machen, der uns verbunden ist?
- Welche Bedeutung hat die bleibende Erwählung Israels für unser Verhältnis zum jüdischen Volk heute? Nie zwingt er seinen Bundespartnern einen Vertrag auf, diktiert ihnen Vorbedingungen.
Nächste Folge:
Das verlorene Schaf (Lukas 15,1-10)

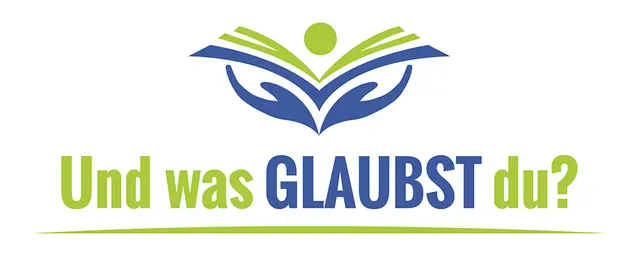
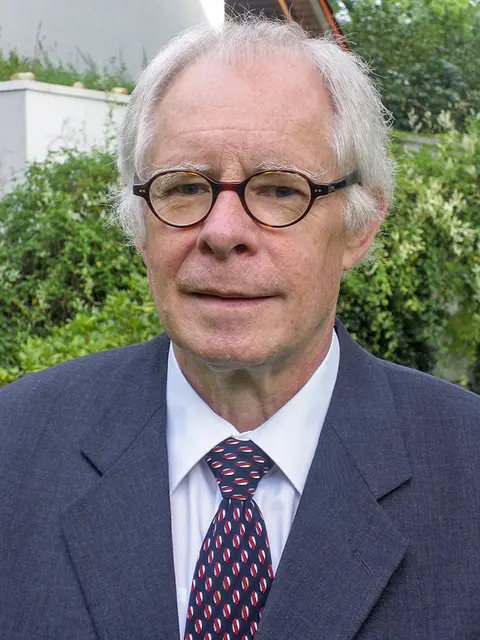
Autor:Online-Redaktion |

Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.