Oktober 1868 - Johannes Brahms
Eine musikotheologische Betrachtung
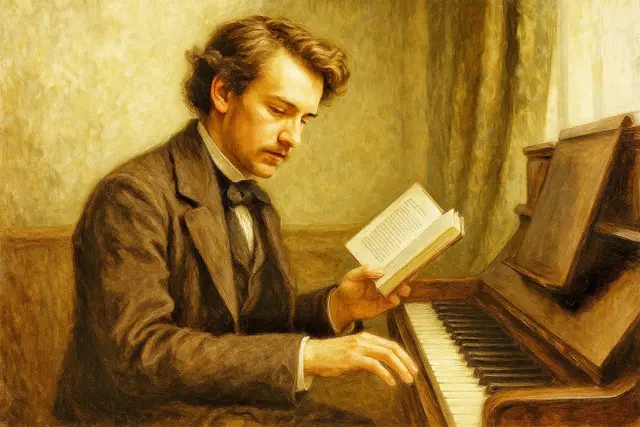
- hochgeladen von Matthias Schollmeyer
Ein später Nachmittag in Wilhelmshaven. An einem jener windstillen Oktobertage des Jahres 1868 - so berichtet uns Albert Dietrich in seinen „Erinnerungen an Johannes Brahms” lag die See unbeweglich da. Brahms, fünfunddreißig Jahre alt, aber längst von jener Schwere gezeichnet, die seine Zeitgenossen später für frühe Reife halten werden, hatte am Morgen das Buch herumliegen sehen. Nun sitzt er am Strand und man weiß nicht, ob er eine Ahnung hat, wie an diesem Tag etwas Entscheidendes geschehen war – die Taufe seines inneren Ohrs. Was denn aber trieb ihn aus dem beschwingten Wien der Habsburger nach Wilhelmshaven, an einen Ort also, der 1868 nichts als ein preußisches Militärgelände gewesen ist?
Freunde wollen sie besuchen und einen Ausflug an diesen unmusischen Ort unternehmen, der damals noch ohne jede Bibliothek war. Zur Kompensation wurde Hölderlins Hyperion mitgeführt.
Ach, wenn er erst wieder in Wien sein wird? Jenen stillen, nach Staub und Geist riechenden Saal, in dem die Bücher still vor sich hin atmen, wird er nach der Rückkehr sofort besuchen. Und dort wird ihm der alte Bibliothekar – ein Typus, wie ihn nur das 19. Jahrhundert hervorzubringen wusste – wird ihm dann ein anderes Exemplar von Hölderlins Hyperion reichen. Man wird das schmale Bändchen in der Hand wie ein Instrument wiegen, tastend, als müsse der Klang des Papiers geprüft werden. Und wird sofort die Stelle suchen, die ihm heute im Eisenbahnwagen von Oldenburg nach Wilhelmshaven so ins Auge fiel. Ein Gedicht Hölderlins, das alles verändern sollte:
„Ihr wandelt droben im Licht,
Auf weichem Boden, selige Genien …”
Es war, als hätte jemand vor ein paar Stunden in der Eisenbahn eine Saite in dem begabten Tonsetzer angeschlagen, die seit Jahren zwar schon gespannt, aber noch nie berührt worden war. Brahms hatte weiter gelesen - langsam, Wort für Wort.
Das Gedicht entfaltet sich wie ein Hymnus an die Unsterblichkeit, doch mitten im allergoldesten Glanz tritt dann unvermeidlich plötzlich der Mensch hervor – unruhig, verloren, das Geschöpf des Sturzes.
Diese Zeile muss in Brahms’ Innerstem widergehallt haben wie ein Donnerschlag. Nun saß er also am Strand, schrieb und fühlte – zum ersten Mal –, dass Musik das sein könnte, was die Theologie nicht mehr wagte. Eine Sprache nämlich, die das Schweigen zwischen Gott und Mensch aushalten kann. Hier, im Angesicht der Zeilen Hölderlins, empfing Brahms tatsächlich seine musikalische Geisttaufe. Und bald sind die ersten Skizzen entstanden- zu einem Werk, das er später Schicksalslied nennen wird, op. 54 - mit drei Sätzen als sinfonische Sache für gemischten Chor und Orchester, aufgeführt am 18. Oktober 1871 in Karlsruhe.
Wenn man heute dieses Werk hört, dieses kurze, erhabene Werk von siebzehn Minuten, dann spürt man, dass hier nicht ein Komponist, sondern ein Eingeweihter etwas hat finden dürfen und es allen, die hören können preis gibt. Die Musik beginnt in Es-Dur klar und ist durchsichtig wie das Licht selbst. Die Stimmen der Chorsänger steigen auf wie die „seligen Genien“, von denen Hölderlin spricht – Wesen ohne Schicksal, atmend wie der schlafende Säugling, unberührt vom Sturm des Lebens. Brahms malt sie nicht nur, er bezeugt sie samt ihrer leidenslosen Welt.
Dann aber kippt der Himmel um. Das zweite Thema, in c-Moll, bricht herein wie eine Erinnerung an das Menschsein. Ruhelos, von Takt zu Takt getrieben, die Streicher wie vom Wind zerrissene Gedanken. Hier ist die Welt des Sturzes, die Friedrich Walther Otto „Heilige Krankheit“ genannt hat (Bonhoeffer hat Ottos Buch „Die Götter Griechenlands” im Tegeler Gefängnis gelesen und fühlte sich davon getröstet.) Der Augenblick, in dem der Mensch erkennt, dass sein Dasein nicht Schicksallosigkeit, sondern Bewusstheit ist - schenkt die Fähigkeit, das Leid zu tragen.
Ihr wandelt droben im Licht,
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die Himmlischen;
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller,
Ewiger Klarheit.Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.
Friedrich Walther Otto und Thassilo von Scheffer, die beiden großen Gräzisten des frühen 20. Jahrhunderts, haben uns gelehrt, die altgriechische Religiosität nicht als Götzenkult, sondern als Form geistiger Ergriffenheit zu begreifen. Der göttliche Ernst, der den Menschen nicht zerbricht, sondern ihn zu Höherem formt. Das Schicksalslied von Brahms steht in dieser Linie. Es ist keine Klage, sondern eine Einweihung in die Tragödie – ein musikalisches Mysterium, in dem das Göttliche durch die Erfahrung des Sturzes hindurch leuchtet.
Der dritte Satz - als Schluss - ist besonders. Denn der Chor muss schweigen. Nur das Orchester bleibt zu hören, wie ein ferner Nachhall der göttlichen Welt. Kein Trost, kein Amen, nur eine Ahnung. Es ist, als öffne sich noch einmal das Licht, in das der Mensch nicht eintreten kann, aber dessen Glanz ihn aus den Fernen dennoch erreicht.
So endet dieses Werk – nicht im Triumph, sondern in der Stille der Ergriffenheit. Und wer es hört, der spürt vielleicht, dass hier etwas von jener starken Heiligkeit anwesend ist, die nicht um Gewissheiten feilschen muss, sondern sich mit der gegönnten Schönheit als Antwort des Unaussprechlichen begnügt.
Autor:Matthias Schollmeyer |

Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.