"greift" Gott in die Geschichte ein?
WAS WÜRDE DAS BEDEUTEN ...
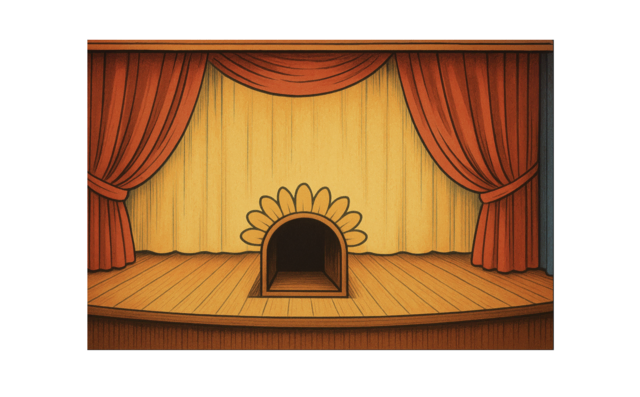
- hochgeladen von Matthias Schollmeyer
Wir Menschen haben seit Jahrtausenden den Drang, unsere eigene Geschichte nicht bloß als Abfolge von Zufällen, sondern als Erzählung mit Sinn zu begreifen. Das ist verständlich. Sinn bedeutet Sicherheit. Und weil der Sinn nicht aus der Geschichte selbst kommt, haben wir ihn von außen hineingetragen – letztlich in Gestalt der Vorstellung des helfend handelnden Gottes.
I. Antike und Israel
Die Griechen sammelten Aufzeichnungen über große Taten und Schlachten: Herodot (ca. 490–424 v. Chr.) war der Chronist der Wunder, Thukydides (ca. 460–um 400 v. Chr.) Analytiker der Macht. Doch eine Geschichte mit göttlichem Ziel kannten sie beide nicht, wenn auch die Schule der Stoiker (ca. 300 v. Chr. in Athen / Zenon von Kition) von einem Logos sprachen, der der Geschichte innewohnen müsste.
Israel dagegen begann schon im 6. Jahrhundert damit, von seiner eigenen Geschichte als Bühne Gottes zu sprechen. Der Auszug aus Ägypten, die Königszeit, das Exil - alles das galt als Kommentar des Himmels, Sieg oder Niederlage und Fülle von wunderbaren Zeichen. Im babylonischen Exil war es - da schuf man sich eine geistige Heimat in Form verbindlich religionsbegründender Urkunden - die später zu jenem Buche zusammengefasst wurden, welche die Christen unter dem Siegel „Schriften des Alten Bundes” kennen wollten:
II. Neues Testament
Hier nun erfolgte nämlich eine Steigerung: Gott selbst solle in dem Menschen Jesus von Nazareth als Gottes Sohn auf die Bühne des historischen Geschehens getreten sein. Sein Leidens- und zugleich Siegeskreuz ward zum Wendepunkt, die Zeit wird seitdem in ein Vorher und ein Danach eingeteilt. Der Glaube lebt fortan in Erinnerung an gewesene Geschichte und Erwartung ihres baldigen Endes, und der Wiederkunft Christi als Vollendung der Geschichte. Diese Erwartung wird später notgedrungen in eine „eschatologische Dauerwarteschleife“ überführt, welche uns heute erklärt, warum die Kirche über Jahrhunderte fortlebte, obwohl sie eigentlich mit einer Naherwartung des Endes der Historie begann.
III. Kirchenväter und Mittelalter
Augustinus fasst die historischen Belange mit einem Bogen höchster Spannung zusammen - in die große Theorie: Civitas Dei und Civitas Terrena. Zwei Städte gäbe es also – die eine von Gott, die andere von den Menschen gebaut. Sie liegen beide gleichzeitig vor - und sind erst nach dem Jüngsten Gericht getrennt. Alles hiesige Weltgeschehen ist aber zugleich schon Station im göttlichen Plan. Dass Augustinus diesen Unterschied nicht geographisch („zwei Städte hier“) verstanden hat, sondern spirituell (zwei Prinzipien, zwei Lieben) ist bekannt. Das Mittelalter überhöht diese Vorstellung dann noch: Geschichte als ein sich entfaltender Baum der Vorhersehung und göttlichen Providenz: Selbst Pest und Kreuzzüge galten als Kapitel im Drama der geschichtlichen Herstellung von Heil.
IV. Renaissance, Reformation, Aufklärung
Dann aber kommt irgendwann der Riss. Machiavelli schon sprach von der Macht und Giambattista Vico (1668–1744) redete später von Kulturzyklen. Er - als neapolitanischer Jurist, Geschichtsphilosoph und Rhetoriker - gilt als einer der Begründer der modernen Geschichtstheorie. Machiavelli brach mit der theologischen Deutung von Geschichte und ersetzte sie durch die Beschreibung eines nüchternen Machtlabors, in dem Menschen selbst das Schicksal gestalten. Luther - um darauf noch hinzuweisen - hält am Gottesbezug fest, aber dieser Gott ist verborgen, entzieht sich unseren Interpretationen und macht jede Providenz-Deutung prekär. Hegel ersetzt Gott - nicht ohne mutwillige Genialität - durch den Weltgeist und Marx schließlich mit den Klassenkampf. Die Dramaturgie bleibt also, nur die göttlichen Protagonisten werden jeweils ausgetauscht.
V. Moderne Katastrophen
Das 20. Jahrhundert schlussendlich? Da sind die Kabel des großen Opernhauses, in dem man so lange das Stücklein von der Ordnung der Geschichte ergötzt sich anschauen durfte, durchgeschmort. Auschwitz, Gulag, Hiroshima: Wer hier noch Providenz und Vorhersehung hören wollte, musste sich schon sehr taub stellen. Theologen wie Moltmann versuchten, ein paar Splitter Hoffnung aus dem Dunkel zu retten – aber der Saal war längst stockfinster. Bereits Jakob Burckhardt hatte längst notiert, die Geschichte sei nur eine böse Schweinerei nach der anderen. Und Oswald Spengler erhob mit seinem Buch "Untergang des Abendlandes" diesen Kulturpessimismus zur Geschichtsphilosophie. Kulturen, so meinte er, sind wie Organismen – sie entstehen, sie blühen, sie sterben. Europa sei längst im Stadium des Alterns und Untergehens. Man mag dies für Fatalismus halten, doch im Angesicht der Katastrophen des 20. Jahrhunderts leuchtet in Spenglers düsterer Diagnose ein Stück Wahrheit auf über die Grenzen menschlicher Geschichtsbemächtigung.“
VI. Die Gegenwart
Und heute? Aus kirchlichen Milieus hört man hin und wieder noch immer die Meinung, es stünde Gott am Dirigentenpult. „Er greift ein, er schafft Frieden“, schreibt man - bzw. liest man dann. Und man meint, sich erinnern zu können an jenes Gute, welches doch in der Geschichte sich (angeblich) so oft schon als Handeln Gottes gezeigt hätte. Nun - wer’s glaubt … Aber wer wollte diesen Glauben aufgeben? Das Dirigentenpult der großen Partitur "Sinn der Weltgeschichte" steht längst leer und verwaist. Was blieb, ist der Souffleurkasten. Aber mit dem gab es ebenfalls eine Veränderung. Früher war diese kleine Hütte in die Bretter, die die Welt bedeuten sollen, gut sichtbar eingefügt - gestaltet wie die halb geöffnete Blüte einer Korbblütlerpflanze. Und man wusste: Hier sitzt - Gott sei Dank - jemand, der flüstern wird, wenn die Texte in Vergessenheit geraten sollten. Heute ist dieser Kasten zumeist zwar nicht verschwunden - aber versteckt. Und im Raum der Kirchen zu sagen, dass die Oper der Geschichte schon immer ohne göttliches Dirigat lief, ist nicht üblich und hätte noch vor 400 Jahren den Weg auf die Scheiterhaufen gebahnt …
VII. 1989 – Fallstudie der Kollision
Beweise für die Unmöglichkeit einer seriösen Geschichtstheologie? Gibt es keine. Gibt es doch - die Wende in der DDR zum Beispiel. Sie galt und gilt immer noch vielen als Wunder Gottes. Kerzen, Gebete, friedliche Revolution. Aber die Archive sprechen auch eine ganz andere Sprache: ökonomische Erschöpfung, Gorbatschows Kurswechsel, Teile der Stasi (die Intelligenteren unter den Genossen), die selbst den Druck aufbaute und sich die besten Plätze für die Nachwendezeit zu sichern wusste. Providentia dei contra providentiam stasiorum? Zwei Deutungen, die sich nur mit allergrößter Mühe vereinbaren lassen. Man hält aber doch gern an der frommen Formel vom Gottesgeschenk der Wendezeit fest, weil sie für bestimmte Milieus Wärme verbreitet. Doch diese Sichtweise kollidiert mit der Aktenlage, und wer beides zusammendenkt, landet in intellektueller Sonderbarlichkeit. Ist zwar nicht schlimm - aber naiv.
VIII. Erheiterungen
Es gibt Bilder, die wirken wie Karikaturen der Weltgeschichte. Man stelle sich ein altes FDGB-Heim an der Ostsee vor, ein grauer Plattenbau, kantig hingestellt zwischen Strandkiefern und Dünen. Wo früher werktätige Helden ihre Ferien mit Skat und Schnaps verbrachten, tagt nun ein in schnellem Flug gegründeter neuer „Bildungsträger“. Und das Seminar heißt: Wie gründe ich meine neue Firma.
Drinnen redet ein Referent aus Hamburg, importiertes West-Know-how in Nadelstreifen. Er zeichnet auf Folien, was eine GmbH ist und wie man sie gründet. Auf den Stühlen sitzen nicht etwa die verunsicherten Ingenieure oder die entlassenen Arbeiter, sondern eine ganz andere Spezies: Stasi-Offiziere aller Ränge. Hauptleute, Majore, jene Männer, die gestern noch Berichte über Nachbarn sammelten, lassen sich nun in die Geheimnisse der Marktwirtschaft einweihen.
Dann kommt die Pause. Fenster auf, Köpfe raus. Man sieht sie rauchen, lachen, winken. Es ist genau das Bild, das Wolf Biermann in seinen unvergleichlichen Spottversen eingefangen hat: „Die Stasi-Leute seien die Einzigen, die nach dem Zusammenbruch fröhlich klotzen.“ hat er gesagt. Und: „Stasischweine im Manager-Rausch.“ Man darf abmildern: „Staasileute im Managerrausch / winken oben zum Fenster raus.”
Das ist der mikrologische Blick auf das, was man früher Geschichtsphilosophie noch nennen konnte. Das FDGB-Heim kippt um zur Groteske: Ein Ort ehemaliger Belohnungsferien wird zum Umschulungszentrum des Opportunismus. Dieselben Gesichter mit neuen Wörtern. Die alte Funktionärsklasse verabschiedet sich nicht – sie zieht ein anderes Kostüm an. Das Bild hat die Leichtigkeit einer bösen Pointe: Revolution als Wochenendseminar. Der Plattenbau bleibt, der Strand bleibt, die Akten sind im Keller, aber oben aus den Fenstern winken die, die schon wieder oben sind. Dann fahren sie nach Hause. Und haben ein Zertifikat in der alten Lederaktentasche, wo früher die Berichte über den Nachbarn drin lagen …
Das alte FDGB-Heim zeigt in einer Szene, was der geschichtliche Umbruch wirklich auch war. Nicht nur Sturz der Mächtigen, sondern ein Kostümwechsel der Funktionseliten. Die Opfer blieben unten, die Täter winken oben zum Fenster raus. Es ergeben sich nun zwei Arten, diesen Essay über die Unmöglichkeit seriös philosophischer Geschichtstheologie zu schließen: ohne Trost und mit Trostpflaster:
IX. Schluss ohne Trostpflaster
Nicht, dass wir die Geschichtstheologie lächerlich machen. Oh nein, das nicht. Sie war der große Versuch, Zufall in Sinn und Niederlagen in Triumphe zu verwandeln. Aber heute stehen wir (nunmehr wissend) vor der grotesken Ruine des Vorstellungskomplexes Geschichtstheologie. Manche gehen in diese Ruine hin und wieder sprachlich immer noch gern einmal hinein - um den Echos der Echos der Echos dort nachzulauschen, wo andere nur kompromittierende Akten rascheln hören.
Man könnte sich am Ende die Frage stellen - wie lange noch lautet unser Auftrag, alte Partituren nachzusingen – oder gar neue Märchen von einem sinnflüsternden Gott zu erzählen, der tatsächlich in die Geschichte eingegriffen hätte? Vielleicht besteht der Auftrag darin, die Leere am Dirigentenpult auszuhalten. Und - damit keine Missverständnisse aufkommen - das ist jetzt kein Trost. Es ist die Realität. Und macht die Würde aus, die denjenigen zuteil wird, die es wagen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen.
X. Schluss mit Trostpflaster
Wenn wir vom Sinn der Geschichte sprechen, so tun wir es heute also mit großer Zurückhaltung. Zu viel Leid, zu viel Irrweg hat die Geschichte des 20. Jahrhunderts in unser Gedächtnis gebrannt. Wer noch von Vorsehung redet, steht schnell im Verdacht, die Katastrophen zu beschönigen oder in eine falsche Harmonielehre einzufügen. Und doch: verzichtet der Mensch gänzlich auf die Frage nach einem letzten Sinn, dann entgleitet ihm die Geschichte ins bloße Chaos.
Die christliche Tradition hat von Anfang an gesagt: Gott ist Logos. Damit ist ausgesagt: Am Ursprung von Welt und Zeit steht nicht blinder Zufall, nicht bloßes Schicksal, sondern Sinn und Vernunft. Diese Vernunft ist nicht abstrakte Idee, sondern lebendige Liebe, die sich im Bund mit Israel und endgültig in Christus gezeigt hat.
Was heißt nun „Providenz“? Nicht, dass Gott jede einzelne Wendung der Weltgeschichte nach einem verborgenen Plan lenkt, als wäre sie ein Schachspiel, in dem er allein die Figuren bewegt. Vielmehr: dass das Ganze der Geschichte in seinen Händen liegt, getragen von einem Sinn, den die Vernunft ahnen und der Glaube erkennen darf. Providenz meint nicht Detailregie, sondern den Horizont, der der Geschichte Richtung und Hoffnung schenkt.
So gesehen ist die Geschichte nicht eine Abfolge sinnloser Brüche, sondern ein Raum, in dem Freiheit und Gnade einander begegnen. Gott zwingt die Freiheit des Menschen nicht, aber er entzieht ihr auch nicht den tragenden Grund. Selbst die Katastrophen, so dunkel sie erscheinen, sind nicht stärker als das letzte Ja, das Gott über seine Schöpfung gesprochen hat.
Damit wird der Glaube an die Vorsehung nicht zur Konkurrenz der Vernunft, sondern zu ihrer Vollendung. Denn wenn die Welt von Logos durchwaltet ist, dann darf Vernunft Vertrauen fassen, dass ihre Suche nach Sinn nicht ins Leere geht. Geschichtstheologie bedeutet daher nicht, alles Geschehene als unmittelbar von Gott gewollt zu deklarieren. Sie bedeutet vielmehr, inmitten der Unübersichtlichkeit der Zeiten die Gewissheit zu wahren, dass die Geschichte nicht sinnlos verläuft, sondern in Gottes Güte ihr Ziel findet.
So bleibt uns die Aufgabe: nüchtern in der Gegenwart zu stehen, die Freiheit verantwortlich zu gebrauchen und doch das Ganze der Geschichte nicht dem Zufall zu überlassen, sondern es im Glauben an die Providenz Gottes zu sehen.
Autor:Matthias Schollmeyer |

Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.